Scandal Love Read online
Page 13
Ein Überfall. Na toll.
Das Letzte, was ich zu ihnen sagte, bevor ich mich in mein Penthouse verzog, um zu duschen und den Nachmittag dazu zu nutzen, sinnentleerte Filme zu glotzen und durch die Seiten der vielen fruchtlosen Berichte zu blättern, die Amanda mir im Lauf der Jahre hatte zukommen lassen, war: »Ich habe kein Interesse an einem Rendezvous.«
Aber natürlich waren die Ehefrauen meiner Freunde um einiges hartnäckiger als sie.
Und wesentlich entschlossener als ich.
KAPITEL 10
EDIE
»Du weißt, wie gern ich dich sehen möchte, aber am Samstag geht’s nicht. Ich wünschte, du würdest zulassen, dass ich dich zu Hause besuche. So übel kann deine Mutter doch gar nicht sein, und ich vermisse … uns«, sagte ich zu Bane, als ich vom Büro aus mit ihm telefonierte. Er war der einzige Mensch, der mir zuhörte. Dem ich wichtig war. Meine Mutter war in letzter Zeit zu sehr neben der Spur, um zu etwas anderem in der Lage zu sein, als im Bett zu liegen und fernzusehen.
»Sag einfach, dass mein Schwanz dir fehlt, und die Sache ist geritzt. Dann haben wir ein Date.« Ich hörte die Wellen, die hinter Bane ans Ufer schlugen. Er unterrichtete wieder im Surfclub. Ich platzte vor Neid.
»So war das nicht gemeint.« Ich rollte mit den Augen. »Ich vermisse dich als Freund.«
»Klar. Wie auch immer. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Und lass dich nicht von Ballaballa-Dad unterkriegen.«
Mein Vater war bestens gelaunt aus der Schweiz zurückgekehrt, woraus ich schloss, dass es mit seiner neuen Liebschaft gut lief. Er regte sich nicht einmal darüber auf, dass das iPad, das ich Trent gestohlen hatte, mit keinem von dessen Accounts verbunden und somit komplett nutzlos war. Jordan gab mir einfach einen weiteren Auftrag und blaffte Befehle, ohne sich eine einzige Sekunde Zeit zu nehmen, um mich zu fragen, wie mein Treffen mit Theo am Samstag gelaufen war. Oder wie es Mom ging. Oder ob ich mit ihr beim Arzt war, weil ihre Medikamente ihr wieder mal zu schaffen machten.
Bane schnaubte. »Dein Vater ist echt das Letzte. Und du bist immer noch krampfhaft bemüht, das ganze Universum auf deinen Schultern zu tragen und damit zum erstbesten Zufluchtsort zu sprinten. Doch das kannst du nicht, Edie. Die Last ist zu schwer. Du wirst zusammenbrechen. Hast du mal versucht herauszufinden, was passiert, wenn du loslässt?«
»Nein.« Erschöpft rieb ich mir übers Gesicht. »Ich werde nie loslassen.«
»Dann wirst du auch niemals frei sein. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes, dein ganzes verfluchtes Leben lang nicht.«
Die Worte trafen mich an einer empfindsamen Stelle, direkt zwischen meinem Magen und meinem Herzen. Weil Bane recht hatte. Meine Lage war hoffnungslos.
Vergangene Nacht hatte ich in mein Kissen geweint, bis sich der Abdruck meines Gesichts darauf abgezeichnet hatte. Ich will nicht lügen – es hatte sich gut angefühlt. Ich hatte mir in Erinnerung gerufen, dass man erst zusammenbrechen muss, um neue Kraft zu schöpfen. Das Problem war nur, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich anfangen und wie ich dieser Misere entkommen sollte.
»Wir sprechen uns später, Gidget.«
»Okay.«
Er beendete die Verbindung als Erster. Bane musste meine Tränen nicht sehen, um zu wissen, dass ich mit den Nerven total am Ende war, aber er hatte mich auch nicht zu einem Schäferstündchen eingeladen. Was er hätte tun sollen. Ich hätte mit ihm geschlafen, um Rexroth eins auszuwischen – wenn auch nur in meiner verkorksten Fantasie.
So fand ich mich jetzt um acht Uhr abends auf der fünfzehnten Etage im Büro wieder und schickte mich an, etwas zu tun, was ich als absolute Grenzlinie betrachtet hatte.
Einbruch und Diebstahl. Würde ich erwischt, wäre mir eine Gefängnisstrafe sicher.
Alle anderen waren längst gegangen. Es war Montag und einer dieser Sommerabende, an denen die ganze Welt im Glück schwelgte, herumsandelte oder sich am Strand ein paar Drinks genehmigte. Ich genoss die Stille und freute mich, dass morgen Dienstag war, weil das bedeutete, dass ich Zeit mit meinen beiden Schätzchen, Camila und Luna, verbringen durfte. Dass mir die ganze Sklavenarbeit erspart bleiben würde, die ich sonst im Büro zu verrichten hatte, war ein zusätzlicher Bonus.
Als ich vor Trents Tür stand, hatte ich das Gefühl, einem Erschießungskommando entgegenzutreten, das direkt auf mein Gewissen zielte. Nicht einmal mir selbst gegenüber konnte ich mein Verhalten länger rechtfertigen.
Ich versuchte, mich damit zu beschwichtigen, dass ich Trents Leben genau genommen nicht wirklich ruinierte. Zumindest nicht aktiv. Was könnte schlimmstenfalls schon passieren? Selbst wenn es meinem Vater gelänge, ihn aus dem Vorstand von Vision Heights Holdings zu drängen, besäße Rexroth immer noch Firmenanteile. Er würde nach wie vor Millionär sein, sein ach so geschätztes Vermögen besitzen. Sehr wahrscheinlich würde er von anderen Unternehmen umworben. Folglich täte ich ihm einen Gefallen. Es war offensichtlich, dass er völlig falsche Prioritäten setzte. Trent könnte mehr Zeit mit Luna verbringen. Er sollte um sie kämpfen, und zwar nicht unter Einsatz von Geld, Kindermädchen und einem Expertenteam, sondern mit seiner Liebe.
Ich zerrte an meiner dämlichen verrutschten Kapuze und holte tief Luft.
Hol einfach den USB-Stick. Das schaffst du.
Jemand saugte den Teppich im Konferenzraum und telefonierte dabei lautstark in einer ausländischen Sprache. Es war die einzige Person auf dieser Etage, und sie würde mich nicht bemerken. Ich war zu weit entfernt. Zu verstohlen. Zu vorsichtig.
Trent sperrte seine Tür nie ab. Er war nicht so paranoid und ängstlich wie mein Vater. Trotzdem wurde der Empfangsbereich vor seinem Büro mit einer Videokamera überwacht, als wäre es das verflixte Pentagon. Da er mich auf dem Bildmaterial problemlos hätte erkennen können und ich alles abzustreiten gedachte, was er mir vorwerfen würde, hatte ich mich auf der Toilette mit meinem schwarzen Kapuzenpulli und einer Jeans getarnt. Nach Wissen der Belegschaft war ich an diesem Tag in einem graublauen DKNY-Kleid zur Arbeit erschienen. Trent könnte behaupten, was er wollte – die Person, die auf dem Überwachungsmaterial zu sehen sein würde, wies keinerlei Ähnlichkeit mit mir auf.
Mit gesenktem Kopf, mein Haar und mein Gesicht von der Kapuze verborgen, stieß ich die Tür zu seinem Büro auf, bereit, zu seinem Schreibtisch zu stürzen.
Ich erstarrte, das Herz klopfte mir bis zum Hals.
Noch ehe meine Augen die Situation erfassten, hörte ich die Geräusche. Das Klimpern von Armreifen, das Klatschen von Haut, die auf Haut traf.
Der Anblick, der sich mir bot, verwandelte meine Knie in Pudding.
Eine Frau, die sich über Trents Schreibtisch beugte, eine Wange an einen Stapel Dokumente gepresst, während ihr flammend rotes Haar sich über ihre Schultern ergoss. Er stand voll bekleidet hinter ihr und stieß in sie hinein, dabei hielt er ihren Nacken gepackt wie meinen an dem Tag, als er mich beim Klauen erwischt und mich so zu meinem Auto eskortiert hatte. Wie eine Gefangene.
Ich wusste, dass ich verduften sollte, und zwar schleunigst. Aber die Situation überforderte mich, die Tatsache, dass wir alle auf frischer Tat ertappt waren, die Erkenntnis, dass ich vor Eifersucht kochte. Ich stand da wie angewurzelt, konnte den Blick nicht losreißen. Ich musste mich nicht erst bemerkbar machen. Mit albern aufgesperrtem Mund stand ich vor ihnen und knetete die Türklinke mit meiner Hand. Mein Herz pumpte wild, mein Magen rebellierte vor Übelkeit und vor Erregung.
Trent sah mich an, sein Becken bewegte sich vor und zurück. Harte, fordernde Stöße. Er zwirbelte ihre roten Haarflechten zwischen seinen langen starken Fingern. Und er beobachtete mich. Als wäre ich diejenige, die sich für ihn vornüberbeugte und ihn in sich aufnahm. Ich hielt seinem Blick stand.
»Du kommst gerade rechtzeitig für die Acht-Uhr-Show, Van Der Zee.« Sein gleichmütiger Tonfall bildete einen krassen Kontrast zu dem wüsten Schauspiel, das er seinem Publikum darbot. Mir. »Ich weiß, wonach du suchst. Es ist in meiner Tasche. Aber aufgepasst – zu diesem Spiel gehören zwei. Falls du dich nicht vom Acker machst, bevor ich hier fertig bin, werde ich dic
h jagen. Und ich werde dich kriegen. Anschließend wirst du singen, Edie. Du wirst mir haargenau erklären, wieso dein Vater so sehr von mir besessen ist. Darum verzieh dich besser.«
Das war der Moment, in dem jeder vernunftbegabte Mensch um sein Leben gelaufen wäre. Ich sollte seinen Rat beherzigen, mich umdrehen und die Flucht antreten. Aber allmählich fand ich mich mit der Tatsache ab, dass ich wahrscheinlich nicht ganz richtig im Kopf und es mit meiner Vernunft nicht weit her war, was Trent Rexroth betraf. Ich senkte den Blick und musterte die Frau. Ihre aufgerissenen Augen verrieten, dass sie nicht darauf stand, in flagranti erwischt zu werden, trotzdem bog sie sich weiter seinen Stößen entgegen. Bestürzung und Verlegenheit spiegelten sich in ihrer Miene. Sie starrte mich an, als würde sie mich kennen. Doch das konnte nicht sein. Sie wirkte älter als Trent, was mir einen schmerzhaften Stich versetzte. Falls er reifere Semester bevorzugte, war er bei mir an der falschen Adresse.
Nicht dass ich ihn etwa würde haben wollen.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf Trent. Seine Augen erzählten mir Lügen, die ich gern glauben wollte, selbst wenn sie von ihm kamen. Sie sagten, dass ich der Samen war, dem alles Schöne auf dieser Welt entspross. Die Luft, das Wasser, die Kunst. Dass ich die Frau war, mit der er schlafen wollte. Sie ließen nichts von den Widrigkeiten, die das Leben ihm aufgebürdet hatte, erkennen und verursachten mir Gänsehaut.
Es fühlte sich an, als würde dieses grüne Monster namens Eifersucht mich jeden logischen Gedankens berauben. Ich musste reagieren, auch wenn ich ihm nicht erklären konnte, was ich hier überhaupt verloren hatte.
»Du wolltest, dass ich dich erwische«, stellte ich mit ruhiger, nur leicht zitternder Stimme fest. Er ging noch immer zur Sache, grub seine Hand in die Taille der Frau, während er so hart in sie hineinstieß, dass der schwere Eichenholztisch über den Granitboden schrappte. Sie schloss die Augen und stöhnte. Er würdigte mich keiner Antwort.
»Du verstößt gegen die Spielregeln«, fügte ich hinzu und lockerte den Griff um die Türklinke. Ich war immer noch auf der Hut, aber meine vorgetäuschte Ungezwungenheit flößte mir Selbstvertrauen ein.
»Ich mache die Sache nur interessanter.«
»Du spielst ein falsches Spiel«, beharrte ich unerklärlicherweise. Vielleicht, weil es sich leider Gottes so anfühlte. Als gehörte er irgendwie mir, auch wenn es keinen Grund für diese Annahme gab.
»Du hast damit angefangen.«
»Inwiefern?«
»Mit Blondie.«
»Bane ist nur ein Freund.«
»Und das mit Sonya nur Sex.«
Ich schluckte und schaute zu der Frau auf dem Schreibtisch. Sie wirkte zu trunken vor Lust, um sich weiter um unseren Schlagabtausch zu kümmern, und ich fragte mich, ob es das war, was einen »echten« Erwachsenen ausmachte. Mein Vater war gleichgültig. Trent war gleichgültig. Seine Freunde waren es, genau wie die ganze Belegschaft hier. Die einzige Person, der Liebe wichtig war – meine Mutter –, hatte darüber den Verstand verloren.
Das aufgeknöpfte Oberteil von Sonyas dunkelblauem Kleid ließ ihren Brustansatz sehen. Ihr lautes Stöhnen und die Art, wie sie vor Erregung die Augen verdrehte, ließen keinen Zweifel daran, dass nicht nur er sie als Objekt betrachtete, sondern sie ihn ebenfalls.
Ich hasse dich, formte ich mit den Lippen und nahm meine schweißnassen Hände von der Klinke. Es war an beide gerichtet. Ich rechnete nicht damit, dass Trent die Worte entschlüsseln konnte – sowieso handelte es sich eher um eine persönliche Feststellung –, dabei vergaß ich, dass er mit einem Menschen zusammenlebte, von dem er sich verzweifelt wünschte, er würde einmal etwas laut aussprechen.
»Gut so.« Er reckte feixend das Kinn vor. »Das beruht nämlich auf Gegenseitigkeit. Ich werde dich auf die Knie zwingen, Schätzchen. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.«
»So redet man nicht mit einem Kind, Rexroth«, spottete ich und grinste ebenso breit wie er. Ich drehte mich auf dem Absatz um und stolzierte davon, ohne die Tür hinter mir zu schließen. Trent behauptete zu wissen, weshalb ich gekommen war, und ich glaubte ihm. Die Nummer mit Sonya war seine Retourkutsche dafür, dass ich eigenen Angaben zufolge mit Bane geschlafen hatte. Die Frau war per se nicht Teil unseres Spiels, sondern für ihn nur Mittel zum Zweck, um den Ausgleich zu erzielen.
Auf dem Weg zum Parkdeck war ich darauf gefasst, dass er mir folgen, mich zu sich herumwirbeln und zwingen würde, stehen zu bleiben. Denn genau das hätte der einzige Mann, der eine feste Konstante in meinem Leben darstellte, getan. Mich an den Armen gepackt, damit ich ihm zuhörte, klein beigab, gehorchte. Doch Trent war das genaue Gegenteil von Jordan. Zwar liebte er es, mich herumzuschubsen, aber er ging nie zu weit. Der Geruch nach verbranntem Gummi und Benzin stieg mir in die Nase, als ich meine hustende alte Mühle startete und mich mit flatterndem Puls auf dem dunklen Parkplatz umsah. Niemand in Sicht. Die Luft war rein.
Während der Heimfahrt war ich mit den Gedanken nicht bei der Sache, trotzdem schaffte ich es irgendwie mit heiler Haut nach Hause, wo ich meiner Mutter Abendessen kochte. Da sie ständig auf ihr Gewicht achtete, entschied ich mich für Quinoa mit Gemüse und einen Tofu-Burger, den ich im Backofen warm machte. Ich servierte ihr das Essen auf einem Tablett, dann setzte ich mich auf den Rand ihres Betts und schenkte ihr ein Lächeln, zu dem ich mich angesichts meines verrückten Abends zwingen musste. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen, ihre Wangen waren eingefallen. Meine Mutter hatte früher einmal an einer Miss-America-Wahl teilgenommen. Sie war noch immer schön, allerdings auf eine traurige verwelkende Weise. Wie eine Blume im Sand, ohne Wasser, Luft oder Wurzeln. Dabei hatte sie von Jordan nie mehr verlangt, als dass er sie liebte.
Und nicht einmal dazu war er imstande.
»Hast du denn schon gegessen, Liebes?« Sie schnupperte an dem Essen, als fürchtete sie, ich könnte sie vergiften.
»Ja«, schwindelte ich. Dabei war es nicht einmal eine echte Lüge. Ich hatte Kreide gefressen, kredenzt von meinem höchsteigenen dunklen Ritter. Er hatte mir gezeigt, wie er einer Frau Lust schenkte, und ich hatte weiter zusehen wollen, obwohl mir von dem Anblick übel geworden war. Mir wurde die Kehle eng bei der Erinnerung daran, dass Trent Sex mit einer anderen gehabt hatte. Trotzdem ging sie nicht nur mit bitteren Gefühlen einher, sondern seltsamerweise auch mit angenehmen.
Etwas, was einen verrückt macht, kann nicht durch und durch furchtbar sein, oder?
Nicht einmal Eifersucht. Oder Hass. Oder Trent Rexroth.
»Das ist gut. Hast du etwas von Daddy gehört?« Ihr Lächeln war zu matt, um ihr Gesicht zu erhellen. Mein Vater fragte mich nach Rexroth, meine Mutter fragte mich nach meinem Vater, aber niemand fragte nach mir. Oder nach Theo. Oder dem Wellenreiten. Ich stülpte die Unterlippe vor und strich das Laken mit der Handfläche glatt.
»Du weißt doch, wie ihm die Zeitverschiebung immer zu schaffen macht.«
Ich hatte keinen Schimmer, wo mein Vater steckte, aber ich schützte nicht ihn, sondern meine Mutter. Dabei wünschte ich inständig, sie würde sich scheiden lassen und es mir ersparen, an dieser Scharade teilzuhaben. Gemäß kalifornischer Gesetzgebung standen ihr fünfzig Prozent seines Vermögens zu, dabei bräuchte sie nicht einmal fünf, um weiterhin ihren luxuriösen Lebensstil zu pflegen. Irgendwann würde ich sie dazu kriegen, sich einfach von ihm zu befreien. Doch zuerst musste sie wieder gesund werden, allerdings war ich nicht hundertprozentig überzeugt, ob sie das überhaupt wollte.
Insgeheim hatte ich den Verdacht, dass ihre Hilflosigkeit bloß eine Finte war. Solange sie in solch schlechter Verfassung war, konnte mein Vater sie nicht abservieren, wie er es mit seinen Geliebten machte. Das würde seiner Karriere aus zweierlei Gründen den Todesstoß versetzen: Es würde ihn entsetzlich gefühlskalt erscheinen lassen – was er war – und sie zu einer tickenden Zeitbombe machen, die alle seine schmutzigen Geheimnisse ausplaudern könnte.
Meine Mutter streckte sich im Bett aus und sah flüchtig zu ihrem Flachbildfernseher. Sie guckte irgendeine Seifenoper, ohne sich wirklich darauf zu konzentrieren. Der Ton war au
f stumm geschaltet, was meine Gedanken unwillkürlich auf die Rexroths lenkte.
»Ich finde, wir sollten alle zusammen verreisen, sobald er zurück ist«, meinte sie und zerrte an ihren blonden Locken, als würden sie sie stören. Ich fasste ihre Hand und gebot ihr Einhalt, bevor sie sich noch die Haare ausriss.
»Sicher, Mom. Das wäre schön.«
Es war acht Jahre her, seit wir das letzte Mal zu dritt in Urlaub gefahren waren. Eines Nachts hatte Jordan sich davongeschlichen, um sich mit einer Hulatänzerin zu verlustieren. Meine Mutter hatte in der Sauna einen klaustrophobischen Anfall erlitten – vermutlich wegen seines Verschwindens – und war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Überflüssig zu erwähnen, dass sich mein Bedürfnis nach Familienausflügen seither in Grenzen hielt.
»Liegt dir irgendetwas auf der Seele, Edie? Du wirkst ungewöhnlich still.« Sie drückte die Pausetaste des Fernsehers und legte stirnrunzelnd die Hand an meine Wange. Ihr Zimmer war riesig und ganz in Weiß gehalten. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Die Luft war abgestanden, weil meine Mutter den ganzen Tag hier herumsaß, und roch nach altem Chanel-Parfum. Ich wünschte, ich könnte ihr von Trent erzählen. Von Theo. Von Bane. Von Sonya. Von Jordan und den kriminellen Aktivitäten, zu denen er mich durch Erpressung zwang. Ich wünschte, ich könnte ausnahmsweise einmal die Tochter in unserer Beziehung sein und mich bei ihr ausheulen. Stattdessen rollte ich mit den Augen und tätschelte ihr zugedecktes Knie.
»Es geht mir gut. Alles bestens. Übrigens hast du morgen um halb zehn einen Arzttermin. Machst du dich allein fertig, oder soll ich dich wecken? Ich würde vorher nämlich gern ein paar Wellen abreiten.«
»Mach nur. Ich werde bereit sein. Wir fahren zu Dr. Fox, oder?«
»Nein.« Ich zog die Nase kraus und bedachte sie mit einem schiefen Blick. Dr. Fox war ihr Schönheitschirurg. »Zu Dr. Knaus.« Sie nahm an, sie würde Botox gespritzt bekommen? Und dass ich mir einen ganzen Tag freinehmen würde, um sie hinzubringen?
»Ach, zu dem.« Sie schürzte die Lippen und verdrehte die Augen gen Zimmerdecke. »Ehrlich gesagt, denke ich, ich sollte die Tabletten einfach absetzen, Edie. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass sie einen richtig wirr im Kopf machen. Diese Psychopharmaka vermitteln einem das Gefühl, als würde ein schweres Gewicht von einem genommen, und man wird süchtig danach. Es ist ein endloser Teufelskreis. Ich brauche sie nicht.«

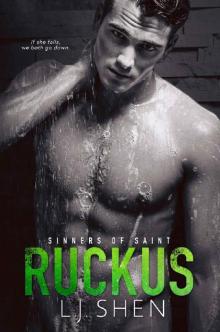 Ruckus
Ruckus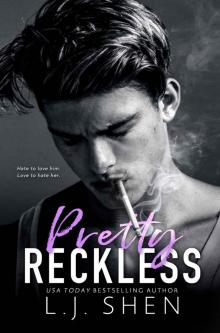 Pretty Reckless (All Saints High)
Pretty Reckless (All Saints High)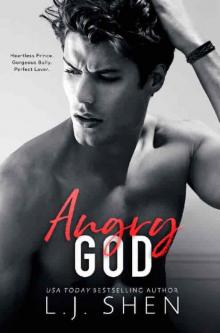 Angry God
Angry God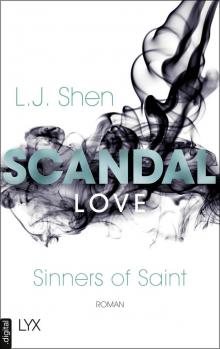 Scandal Love
Scandal Love Bad Cruz
Bad Cruz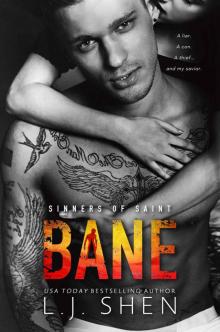 Bane (Sinners of Saint Book 5)
Bane (Sinners of Saint Book 5)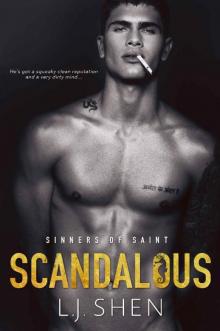 Scandalous (Sinners of Saint Book 4)
Scandalous (Sinners of Saint Book 4)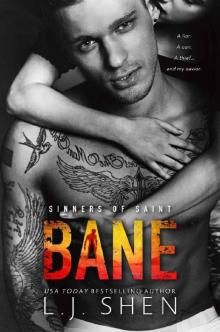 Bane (Sinners of Saint)
Bane (Sinners of Saint)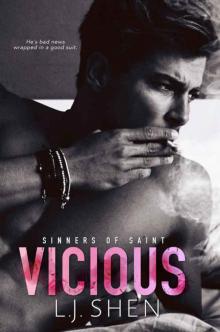 Vicious (Sinners of Saint #1)
Vicious (Sinners of Saint #1)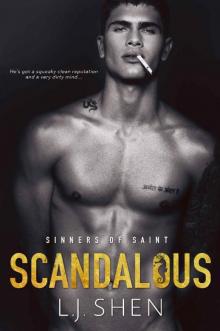 Sinners of Saint 04 - Scandalous
Sinners of Saint 04 - Scandalous In the Unlikely Event
In the Unlikely Event Tyed
Tyed Sparrow
Sparrow Midnight Blue
Midnight Blue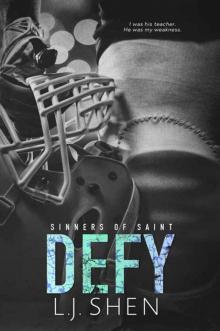 Defy (Sinners of Saint Book 2)
Defy (Sinners of Saint Book 2)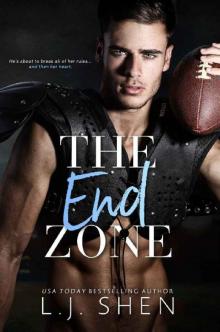 The End Zone
The End Zone