Scandal Love Read online
Page 8
Wellenreiten war nicht prestigeträchtig genug, um einer Van Der Zee würdig zu sein.
Meine Surfbretter versteckte ich unter schweren braunen Planen in einer der Garagen, wo Gäste sie nicht einmal durch Zufall entdecken konnten, und sämtliche Familienfotos, die ich in meinem Zimmer aufgehängt hatte, waren noch am selben Tag wieder abgenommen worden, einzig die nackten Nägel in den korallenroten Wänden zeugten davon, dass dieser Raum einmal warm und mein Reich gewesen war.
Niemand wusste auch nur das Geringste über mein wahres Ich, weil ich nicht perfekt war, der Rest der Van Der Zees dagegen schon.
Wenn auch nur dem äußeren Anschein nach.
Wir waren wie die Brady-Familie, nur ohne die Kinderschar. Blond und gut aussehend, unser Markenzeichen das breiteste Zahnpastalächeln weit und breit.
Ich schlüpfte in einen orangefarbenen Bikini, einen passenden Neoprenanzug und einen schwarzen Kapuzenpulli, anschließend simste ich Bane. Wir gingen nicht mehr zusammen wellenreiten, seit ich meinen perspektivlosen Job angetreten hatte, trotzdem lud ich ihn immer noch dazu ein. Es war ätzend, allein in pechschwarzer Nacht zu surfen, und dazu extrem gefährlich, aber mir blieb kaum eine Wahl. Ich fing um sieben Uhr morgens im Büro an und machte frühestens nach zwölf Stunden Feierabend. Im Anschluss musste ich nach meiner Mutter sehen, sie bekochen und sicherstellen, dass es ihr gut ging. Irgendwer hatte diese Aufgabe schließlich zu übernehmen, und Jordan würde es ganz bestimmt nicht, so viel stand fest.
Ich trat in die Küche, um mir ein Kokosnusswasser und einen Müsliriegel zu holen. Ringsum Arbeitsflächen aus blutrotem Granit und blitzende Edelstahlgeräte. Es war einer meiner Lieblingsräume in der Villa, weil mein Vater sich nur selten hierher verirrte. Wann immer er daheim war, ließ er sich das Essen von einer unserer Haushälterinnen auf sein Zimmer bringen. Er kam nur in die Küche, um meiner Mutter einen Tee zu machen, was das Einzige zu sein schien, was ihre Not leidende Seele zu beschwichtigen vermochte.
»Mom?«, entfuhr es mir, als mein Blick auf einen schmalen, gebeugten, von einem cremefarbenen Satinmorgenmantel verhüllten Rücken fiel. »Wieso bist du auf?«
Sie saß an dem Marmoresstisch und starrte auf einen Artikel in einer Lokalzeitung. Ich ging zu ihr und hauchte einen Kuss auf ihr blondes Haar.
»Hey«, sagte ich sanft. »Kannst du nicht schlafen?«
»Wer ist April Lewenstein?« Sie tippte mit einem abgekauten Fingernagel auf ein Foto, das während einer VHH-Veranstaltung aufgenommen worden war. Es zeigte meinen Vater mit einer jungen Frau im Arm, beide lächelten in die Kameras. Meine Mutter rieb mit dem Finger über das Bild, bis die zwei Gesichter von Druckerschwärze verschmiert waren. Ich seufzte nachsichtig, meine Schultern entspannten sich.
»April arbeitet in der Buchhaltung, auf der siebten Etage. Sie ist verheiratet und im fünften Monat schwanger. Du musst dir keine Sorgen machen. Geh wieder zu Bett.«
Ihr Kopf fuhr zu mir herum. Ihre Lippen wirkten unnatürlich voll, ihre Haut zu straff von den vielen Injektionen, und ihre blutunterlaufenen Augen zeugten von einem weiteren unausgewogenen Cocktail aus Medikamenten, für die wir neue Rezepte besorgen mussten.
»Du würdest es mir doch sagen, wenn du wüsstest, dass er mich betrügt?« Ihre Finger krallten sich in meinen Neoprenanzug und zogen mich näher heran.
Ich zuckte gleichmütig die Achseln.
»Selbstverständlich.« Eher friert die Hölle zu. Im gegenwärtigen Augenblick kam Lydia Van Der Zee nicht einmal damit zurecht, dass unser Pool aufgrund von Wartungsarbeiten für den restlichen Sommer nicht benutzt werden konnte. Doch ich sagte ihr, was sie hören wollte, weil kleine Notlügen es leichter machten, mit ihrer psychischen Labilität zu leben. Für mich, versteht sich, nicht für sie.
»Wie läuft es bei der Arbeit, Engelchen?« Sie ließ mich los. Mein Blick huschte zu der Uhr über dem Kühlschrank. Ich schuldete ihr zumindest ein wenig Gesellschaft, darum setzte ich mich auf den Stuhl neben sie, schraubte das Kokosnusswasser auf und trank einen Schluck. »Prima. Jordan hat sich die größten Mistkerle der Stadt als Geschäftspartner ausgesucht. Ich kann es nicht erwarten, dass er ein neues Lieblingsprojekt findet, in das er seine ganze Zeit investiert.«
Vision Heights Holdings war nur ein weiterer Strang im Imperium meines Vaters. Jordan hatte schon so viele Firmen aufgekauft und übernommen, dass ich sie kaum noch zählen konnte. Er behandelte seine Unternehmen wie seine Geliebten, indem er sie im ersten Jahr mit allem versorgte, was sie brauchten, bevor sie ihn zu langweilen begannen und er sie ihrem Schicksal überließ, um sich in ein neues aufregendes Abenteuer zu stürzen.
»Darüber weiß ich nichts«, murmelte meine Mutter und zupfte an ihrer aufgespritzten Unterlippe. »Ihm gefällt der Gedanke, mit Baron Spencer und seinesgleichen auf Du und Du zu stehen. Sie sind einflussreiche Persönlichkeiten, und er will für das Amt des Bürgermeisters kandidieren.«
Der Hauptsitz von Vision Heights Holdings war in Beverly Hills, im riesigen L. A., aber wir lebten in Todos Santos, und diese Stadt war klein. Beängstigend klein sogar (zur Erinnerung: mein Versuch, ausgerechnet der Mutter meines Chefs die Handtasche zu klauen).
Folglich musste Lydia mich nicht darauf hinweisen, dass Trent Rexroth eine große Nummer war. In letzter Zeit dachte ich unentwegt an ihn, und das nicht nur während der Arbeit, darum hatte ich es mir zum Prinzip gemacht, ihn zu vergraulen, sobald er in meiner Nähe auftauchte.
»Dein Vater verhält sich eigenartig. Er geht wieder fremd, da bin ich mir sicher. Ich fürchte, dieses Mal ist es etwas Ernstes.«
Ich schenkte ihr ein tröstendes Lächeln. »Das bezweifle ich.« Nicht dass er sie betrog – das tat er hundertprozentig –, sondern dass es ernst war.
Sie rieb sich erschöpft die Wange. »Er war früher nie so lange oder so häufig auf Geschäftsreise.«
»Vielleicht trifft er sich mit Geldgebern et cetera, um sich auf den Wahlkampf vorzubereiten.« Allerdings hatte er schon seit geraumer Weile nicht mehr von seinen politischen Ambitionen geredet, was bedeutete, dass sie ihn nicht länger beschäftigten. Jordan Van Der Zee liebte nämlich nichts mehr als den Klang seiner eigenen Stimme.
Die Küchentür machte ein leises Geräusch, und ich riss instinktiv den Kopf herum, bereit, mir ein Steakmesser aus einer Schublade zu schnappen und den Eindringling in die Flucht zu schlagen. Als ich sah, dass es der Teufel persönlich war, der in der Tür lehnte, stieß ich seufzend den Atem aus, doch ich beging nicht den Fehler, mich zu entspannen.
»Du bist auch schon auf? Was ist los mit euch? Es ist erst halb fünf«, murmelte ich und klammerte mich an meinem Getränk fest. Das Wochenende rückte immer näher, und ich durfte Jordan nicht vergrätzen. Der Besuch am Samstag bedeutete mir viel, darum musste ich mich unbedingt von meiner Schokoladenseite zeigen.
»Edie und ich haben etwas zu besprechen. Geh wieder zu Bett, Lydia. Ich bereite dir gleich einen Tee.« Obwohl seine Missbilligung meiner Mutter galt, machte das die Sache nicht besser. Resigniert erhob sie sich und verließ das Zimmer, fast wie ein Geist. Jeder ihrer Schritte drückte Vernachlässigung, mangelnde Zuwendung und Schwäche aus. Ihre Seele hatte genügend Misshandlung erlitten, um sie restlos zu brechen, und auch wieder nicht genug, als dass ich damit zur Polizei hätte gehen können. Balance, hatte Rexroth gesagt, ist das Wichtigste im Leben. Gott, wie sehr er doch recht hatte.
Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Du wirst wegen dieser Sache nicht die Beherrschung verlieren, Edie. Vergiss das Wellenreiten, seine Egospielchen und sein Dominanzgehabe. Konzentriere dich auf das Wesentliche.
Jordan riss mir die Flasche Kokoswasser aus der Hand und versenkte sie in einem der beiden riesigen Spülbecken der Kücheninsel.
»Ich war gerade dabei, das zu trinken.« Jedes meiner lapidaren Worte triefte vor Verachtung.
»Jetzt nicht mehr. Und das Surfen kannst du dir auch abschminken … Das ist was für Hippies. Die Van Der Zees trinken morgens Kaffee. Er sorgt für einen klaren Kopf.«
»Du bringst Mom zweimal täglich Tee.« Ich
grinste.
»Deine Mutter ist keine Van Der Zee. Sie hat ihren Status mittels Heirat erlangt.«
Da es keine Möglichkeit gab, ihm zu antworten, ohne einen Dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen, hielt ich den Mund.
»Wir müssen reden, Edie.«
»Ich dachte, das täten wir gerade.«
Er beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf dem Tisch auf. Sein ernster Gesichtsausdruck verriet, dass er wieder mal enttäuscht von mir war, auch wenn ich nicht den blassesten Schimmer hatte, warum.
»Ich habe dein gestriges Intermezzo mit Rexroth im Pausenraum mitbekommen. Die gesamte Etage wurde Zeuge davon.«
Mein Blick zuckte zu ihm, und mir fiel die Kinnlade runter, ehe ich mir eine Erwiderung überlegen konnte. Falls mein Vater den Verdacht hegte, dass ich mit Rexroth flirtete, würde er mir noch den Rest von dem wegnehmen, was mir wichtig war. Das durfte ich nicht zulassen.
»Hör zu –«, setzte ich an, aber er brachte mich mit einer unwirschen Handbewegung zum Schweigen.
»Meine Tochter wäre nicht so dumm, seinem rüpelhaften Charme zu erliegen. Da bin ich mir ganz sicher, Edie.« Er legte sich seine Krawatte um und band sie, ohne dabei in den Spiegel blicken zu müssen. Ich lehnte mich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Aber ich habe bemerkt, wie er dich ansah, dir auf die Pelle rückte. In Anbetracht des Altersunterschieds zwischen euch und der Tatsache, dass du seit Kurzem bei uns beschäftigt bist, ist das vollkommen inakzeptabel. Ich weiß nicht, was Trent Rexroth im Schilde führt, aber welches Ziel auch immer er verfolgt, er wird es nicht erreichen. Du kennst deinen Vater gut genug, um zu wissen, welche Konsequenzen es nach sich ziehen würde, wenn du mit ihm Umgang hättest, nicht wahr?«
Würde er Trent kaltmachen? Es wäre ihm durchaus zuzutrauen. Er kannte keine Gnade, wenn es darum ging, die Familienehre zu schützen, mit Betonung auf Ehre. Liebe, Gefühle und Fürsorge waren nach seinem Dafürhalten nichts, dem man Bedeutung beimessen musste. Die Erkenntnis, dass diese Unterhaltung in alle möglichen – und noch dazu falsche – Richtungen driften konnte, traf mich wie ein Faustschlag in den Magen, bevor sie bis zu meiner Brust hochstieg und mir die Kehle zuschnürte. Mein Herz war prallvoll mit gebrochenen Versprechen und zweifelhaften glücklichen Augenblicken. Eine Wüstenei aus Hoffnungen und Träumen, die sich ohne Theo niemals erfüllen würden.
»Ich habe kein Interesse an Rexroth, darum kannst du es dir sparen, mich vor ihm zu warnen«, sagte ich und schnippte Reste von Sand aus meinen abgebrochenen Fingernägeln. Er war einfach immer da, egal, wie viel ich daran pulte. Ehrlich gesagt liebte ich das. Weil er mich an den Ozean erinnerte, an das Surfen, die Freiheit.
»Möchtest du, dass ich deinen Stundenlohn erhöhe?« Mein Vater neigte sich vor wie eine schwere Maschine und ergriff roboterhaft meine Hand. Seine Haut war kalt und trocken, die perfekte Metapher für den Mann, der er war. Ich legte mir meine Worte sorgfältig zurecht, während ich unsere Hände betrachtete. Wie unnatürlich sie aussahen, sich anfühlten.
»Na ja, du zahlst mir nur den Mindestlohn.«
»Würde es dir gefallen, wenn ich es so einrichte, dass du Theodore nicht nur samstags, sondern außerdem jeden zweiten Mittwochabend sehen könntest?«, fügte er mit durchtriebenem Lächeln hinzu. Theodore. Nicht Theo. Niemals Theo.
Meine Finger zitterten, es juckte sie, sich seinem Griff zu entziehen. Ich sehnte mich danach, Theo wieder zu berühren, sein Gesicht zwischen meinen Händen zu spüren, sein Lachen auf meiner Haut. Seine Seele eins mit meiner. Andererseits kannte ich Jordan gut genug, um zu erkennen, dass der Köder, den er mir unter die Nase hielt, vergiftet war. Meine Hand brannte noch immer von seiner Berührung, ich wollte sie mit Seife waschen, sie schrubben, bis sich die oberste Hautschicht abschälte. Er beugte sich näher zu mir, sein Atem roch nach Pfefferminzzahnpasta und Bosheit.
»Ich brauche deine Hilfe, Edie. Es gibt einen Auftrag zu erledigen, und du bist die perfekte Kandidatin hierfür.«
»Ich bin ganz Ohr«, sagte ich, gespannt darauf, wohin das führen würde.
»Es geht um Trent Rexroth. Ich möchte, dass du ihn bespitzelst und herausfindest, was er im Schilde führt.«
»Warum?« Man musste kein Genie sein, um zu erkennen, dass die beiden sich hassten. Andererseits sammelte mein Vater Feinde wie andere Leute Briefmarken oder Weihnachtskarten. Beflissen und passioniert. Jede einflussreiche Person, der er begegnete, wurde eingeschätzt, kategorisiert und wie eine nationale Bedrohung behandelt. Der Begriff Egomane war speziell für ihn erfunden und durch ihn geprägt. Jordan Van Der Zee hatte kein Problem damit, liebenswürdig zu Menschen zu sein, die weniger verdienstvoll, reich und wichtig waren als er. Doch sobald man sich als Konkurrent oder Hindernis entpuppte, überrollte er einen wie eine Dampfwalze, stieß dabei vor und zurück, nur um auf Nummer sicher zu gehen.
»Seine Schweigsamkeit raubt mir den letzten Nerv, und er stellt sich unentwegt gegen mich. Er heckt etwas aus, und ich will wissen, was es ist. Ich will wissen, was er hinter seiner verschlossenen Bürotür treibt. An welchen Tagen er seine Tochter zur Therapie bringt. Was in seinem Terminkalender steht. Wo sich sein Safe, seine Akten und sein iPad befinden. Ich. Will. Alles. Wissen.«
Offensichtlich glaubte er, dass Trent Rexroth hinter seinem Rücken irgendeinen intriganten Plan schmiedete. Eine feindliche Übernahme, wahlweise einen Überraschungsangriff, der seine geliebte Investmentgesellschaft in Gefahr bringen könnte.
Trent Rexroth erweckte zweifelsohne den Eindruck eines Kontrollfreaks. Womöglich hatte Jordan tatsächlich Grund zur Sorge. Nur machte das für mich nicht den geringsten Unterschied. Denn so schwer es mir auch fiel, darauf zu verzichten, Theo mittwochs zu sehen, wollte ich mir nicht ein noch tieferes Grab schaufeln, indem ich mich von meinem Vater auf diese Weise manipulieren ließ. Es war eine ausweglose Situation. Entweder war es eine Lüge, dass er mir mehr Zeit mit dem einzigen Menschen, der mir etwas bedeutete, zugestehen wollte, oder aber er meinte es ernst und setzte damit ein Signal für weitere Erpressungen, wenn er einmal damit durchkam. Es war ein zweischneidiges Schwert, das mein Herz zum Bluten brachte.
»Nein danke«, sagte ich langsam und klopfte mit dem Daumen gegen die Tischkante. »Such dir jemanden, der bereit ist, den Auftrag anzunehmen.«
»Meine liebe Tochter.« Er nahm wieder meine Hand und zog absichtlich an meinem Arm. Es tat nicht weh, war aber alles andere als angenehm. »Du wirst tun, was ich dir sage. Die Boni sind nur ein kleiner Schubs in die gewünschte Richtung. Dir bleibt keine andere Wahl.«
»Ich werde Trent Rexroth nicht ausspionieren.« Meine Stimme wurde lauter, fester. »Er hat mir nichts getan, abgesehen davon bist du bei mir an der falschen Adresse. Rexroth kann mich nicht ausstehen.« Das war eine Untertreibung. Ich war überzeugt, dass er eher einem Neonazi vertrauen würde als mir.
Selbstredend reagierte mein Vater ungerührt auf meinen wachsenden Widerstand. »Falls du es nicht tust, Edie, schicke ich Theodore nach New York. Du weißt, dass ich die nötigen Verbindungen dafür habe. Seine Einrichtung in San Diego ist hoffnungslos überfüllt. Ich würde ihm einen Gefallen erweisen.«
Zurück in vertrauten Gewässern. Das klang schon mehr nach ihm. An die Drohungen war ich gewöhnt. »Jemanden durch Erpressung dazu zu zwingen, Spionage zu betreiben, ist auch nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie du das anstellen willst. Theodore in eine zweitklassige Einrichtung zu verlegen, während du für das Bürgermeisteramt kandidierst. Jemanden, von dem du nie wolltest, dass irgendwer von ihm erfährt«, entgegnete ich trocken. Ich hasste ihn und Rexroth und die ganze Welt dafür, dass sie meinem Glück im Weg standen. Ich pfiff auf das Geld, den Glamour oder die verstümmelten Louboutins. Das Einzige, was ich wollte, war surfen und in Theos Nähe sein. Dass diese Dinge unerreichbar schienen, gab mir das Gefühl, ein unter einer Glasglocke gefangener Schmetterling zu sein. Ein winziges Geschöpf, das gegen das Hindernis prallt, bis ihm die Kraft, der Atem, die Hoffnung ausgehen.
»Du wirfst mit dem Wort Erpressung für meinen Geschmack etwas zu oft und zu
laut um dich, junge Dame. Betrachte es als Recherche«, schlug er vor und ließ meine Hand los.
»Nenn es Recherche oder Erpressung oder was auch immer. Die Antwort lautet Nein.«
Es war inzwischen fünf Uhr morgens, somit hatte ich mein Zeitfenster fürs Surfen offiziell verpasst. Scheiß drauf, einmal pro Woche durfte ich erst um acht zur Arbeit erscheinen. Die Stuhlbeine kratzten über den Boden, als ich aufstand.
Etwas landete mit einem lauten Knall auf dem Tisch.
Mein Kopf fuhr herum.
Eine Tasche.
Die Arzneitasche meiner Mutter.
Sie hatte schwer geklungen, denn genau das war sie. Weil Lydia mittlerweile drei Tabletten brauchte, nur um aus dem Bett aufzustehen, außerdem ihre Vitamine – nach denen sie süchtig war –, die Gummibärchen, die einen strahlenden Teint, kräftige Fingernägel und einen tiefen Schlaf versprachen und die sie den ganzen Tag über futterte. Abends nahm sie drei weitere Pillen, um einzuschlafen.
»Lass dir deine Entscheidung noch mal durch den Kopf gehen. Es gibt zwei Menschen, an die du denken musst. Der eine – deine Mutter – ist ein hilfloses Kind, gefangen im Körper einer Frau. Du hast sämtliche Brücken hinter dir abgebrochen, um die beiden zu retten, Edie. Jede einzelne. Angefangen bei deiner Ausbildung bis hin zu deinem Traum, Profisurferin zu werden, um von hier, um von mir wegzukommen. Du hast alle diese Opfer für deine Mutter und für Theodore gebracht. Da kommt es auf eines mehr nicht an.«
Ich stand mit dem Gesicht zum Flur, während ein markerschütternder Schrei in meiner Kehle aufstieg und meinen Körper erzittern ließ. Mein Vater hatte mich exakt dort, wo er mich haben wollte, und das wusste er. Er kam auf mich zu, eingehüllt in eine Wolke aus Selbstgefälligkeit, die den Raum mit einem üblen Geruch verpestete.
»Täusch dich ja nicht in mir, Edie. Ich werde deine Mutter und deine weggeschlossene Obsession ohne Bedenken opfern. Du hast eingewilligt, meine gehorsame kleine Marionette zu sein … Folglich bestimmst nicht du die Regeln.«

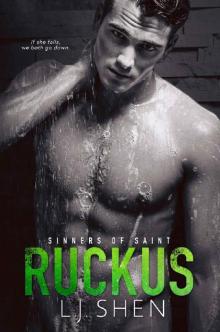 Ruckus
Ruckus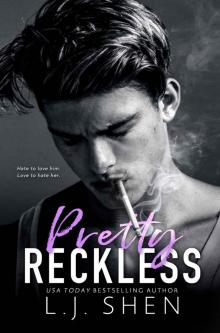 Pretty Reckless (All Saints High)
Pretty Reckless (All Saints High)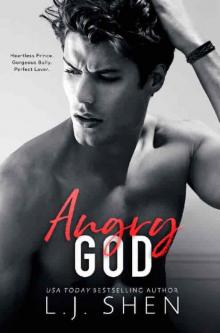 Angry God
Angry God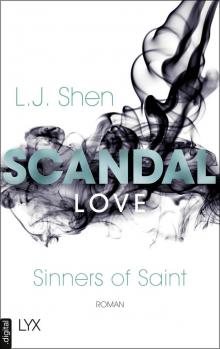 Scandal Love
Scandal Love Bad Cruz
Bad Cruz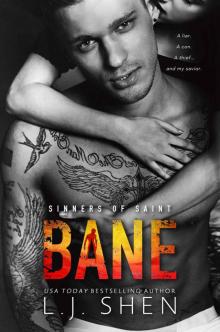 Bane (Sinners of Saint Book 5)
Bane (Sinners of Saint Book 5)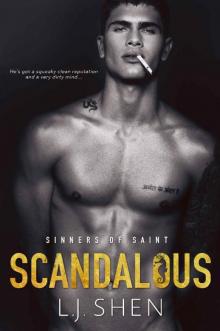 Scandalous (Sinners of Saint Book 4)
Scandalous (Sinners of Saint Book 4)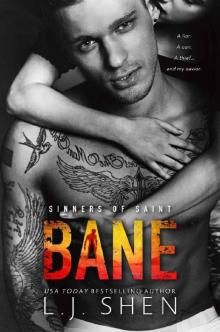 Bane (Sinners of Saint)
Bane (Sinners of Saint)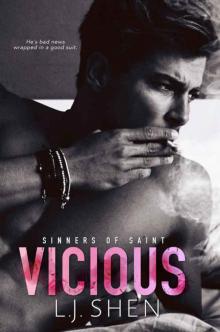 Vicious (Sinners of Saint #1)
Vicious (Sinners of Saint #1)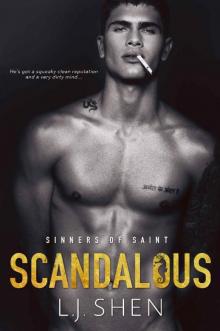 Sinners of Saint 04 - Scandalous
Sinners of Saint 04 - Scandalous In the Unlikely Event
In the Unlikely Event Tyed
Tyed Sparrow
Sparrow Midnight Blue
Midnight Blue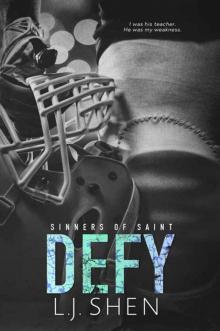 Defy (Sinners of Saint Book 2)
Defy (Sinners of Saint Book 2)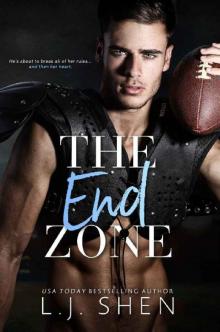 The End Zone
The End Zone